Idiopathische Skoliose ?
Ein alternatives Entstehungs -und Therapiekonzept
Genau das ist das Problem!
Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen kann nicht irgend etwas entstehen, ohne daß dafür eine treibende Kraft - getreu dem Prinzip von Ursache und Wirkung - existiert.
Daß medizinische Sachverhalte, wie z.B. auch der der "essentiellen Hypertonie" idiopathisch sein sollen, scheint allein ein Problem der Schulmedizin, nicht aber das einer Naturwissenschaft zu sein.
Idiopathische Skoliosen sind immer erworben und grundsätzlich funktioneller Natur!
Sie entstehen zwangsläufig im Gefolge der Ausbildung spezifischer individueller Blockierungsmuster der Wirbelsäule. Es handelt sich damit um einen ganzheitlichen Vorgang, wobei die Kausalkette unidirektional vorbestimmt ist: initiale Blockierung → Blockierungsmuster → funktionelle Skoliose (Prinzip der Minimierung potentieller Energie).
Wann eine initiale Blockade und in weiterer Folge die Ausbildung von Blockierungsmustern mit parallel dazu verlaufender Skoliosierung einsetzen, hängt neben der Art der akuten und chronischen körperlichen Überlastung vor allem aber auch von der genetischen Disposition (= der Güte des Binde- und Stützgewebes) im Einzelfall ab. Dabei kann einer solcher Vorgang zunächst völlig symptomlos verlaufen.
Erst wenn die biokybernetische Kompensationsfähigkeit des Organismus sich dem Ende zuneigt, beginnt der Körper, mit der reaktiven Ausbildung verschiedenster klinischer Wirbelsäulensyndrome mit ihren spezifischen krankmachenden Folgen zu reagieren [3].
Wie entsteht nun eine idiopathische Skoliose?
Der lumbosacrale Übergang ist die biomechanisch schwächste Stelle des menschlichen Körpers.
Das hat zur Folge, daß hier im Normalfall auch die Initialisierung des Blockierungsgeschehens der Wirbelsäule einsetzt. Dabei ist grundsätzlich ein Iliosacralgelenk (erfahrungsgemäß links > rechts / Ursache ?) betroffen. Das zunächst noch symmetrische Becken rutscht ab und geht in den Schiefstand mit entsprechender scheinbarer Beinverlängerung (meist links / Ursache ?) über. Daraus resultiert ein Potentialunterschied im energetischen Zustand der rechten und linken, aber auch der oberen und unteren Körperhälfte. Auf Grund des naturgemäßen Ausgleichs von Potentialunterschieden muß die initiale Blockade des ISG (Iliosacralgelenk) zunächst eine Blockade der Gegenseite (= Gegenblockade) im Nahbereich bewirken. Diese natürliche Gegenblockade kann nur in L5 zu suchen sein und hat zur Folge, daß die Wirbelsäulenachse (durch L5) noch weiter zur Gegenseite des blockierten ISG auswandert, also der initiale Skoliosewinkel weiter zunimmt.
Zum Potentialausgleich im Fernbereich - also zwischen oberer und unterer Körperhälfte - werden Blockaden in C1 und C2 erzeugt, so daß die (Differential-)Diagnose des Grundblockierungsmusters z.B. ISG li - L5 re / C1re - C2li (sehr häufig) lauten könnte.
Eine Skoliose kann aus immer wieder den gleichen energetischen Gründen nicht nur aus einem Einfachbogen bestehen, sondern muß immer auch einen Gegenbogen aufweisen (Einfachskoliose).
Dazwischen liegt - nicht notwendigerweise symmetrisch - ein neutraler (blockadefreier) Knoten. Die aus den einzelnen Blockaden resultierenden Spannungen können im Sinne einer Nahwirkung aber nur von Punkt zu Punkt (Wirbel zu Wirbel), nicht aber als Fernwirkung ohne Beeinflussung des Zwischenraumes übertragen werden. Deshalb sind neben den Grundblockaden für das Zustandekommen einer Skoliose weitere Blockaden erforderlich. Hierbei handelt es sich um Blockaden niederer Wertigkeit (= höherer Ordnung = Ausgleichsblockaden), die zunächst ohne klinische Relevanz und völlig reversibel sind [3].
Bei mathematisch-biophysikalischer Betrachtungsweise stellt die Form der Skoliose eine stetige Kurve dar, wobei die einzelnen Wirbelkörper in den Spannungsverlauf mit einbezogen werden. Hierin liegt die Erklärung für den Prozeß der Wirbelkörperverwringung (rotatorisches Gleiten) im chronischen Zustand. Diese Stetigkeit scheint auf den ersten Blick an den Blockierungsendpunkten (ISG, C0/C1) in Unstetigkeitsstellen überzugehen. Tatsächlich jedoch setzt sich der Spannungsverlauf sowohl weiter nach kaudal in das Becken als auch nach kranial in den knöchernen Schädel fort und führt letztlich einerseits zur Beckenverwringung mit Fehlbelastung der Hüftgelenke (→Coxarthrose→Endoprothese u.a.) und der unteren Extremitäten (→Kniebeschwerden →Knieprothese u.a.), Dysfunktion der Symphyse (→Blasenbeschwerden, gynäkolog. Beschwerden u.a.), andererseits zu Schädelasymmetrien mit den z. T. alternativmedizinisch bekannten, aber z. T. noch unbekannten Folgen (→Nasenseptumdeviatonen mit vermehrter NNH-Infektanfälligeit, erhöhte allergische Diathese im NNH-Bereich, Zahnfehlstellungen (Infekt- u. Schmerzanfälligkeit) !!, Mund-, Augen- und Ohrfehlstellungen u.a.).
Von Verwringung betroffen ist insbesondere auch der Schultergürtel mit entsprechenden Folgen (→Arthrose der Acromio-Clavicular- bzw. Sterno-Clavicular-Gelenke →Schulter-Arm-Syndrome). Kranialer Blockierungsendpunkt ist HWK1 (C0/1, C1/2) - wiederum mit den entsprechenden Folgen (→Migräne, Konzentrationsstörungen, Tinnitus, Ménière-ähnliche Symptomatiken u.a.). Ausdruck der Skoliosierung ist hier regelmäßig eine z. T. massive Lateralisation.
Die auf die einzelnen Wirbelkörper wirkenden Kräfte (Spannungen) sind doppelter Natur und haben unterschiedliche Entstehungsursachen:
1. Infolge des Blockierungsgeschehens entsteht durch
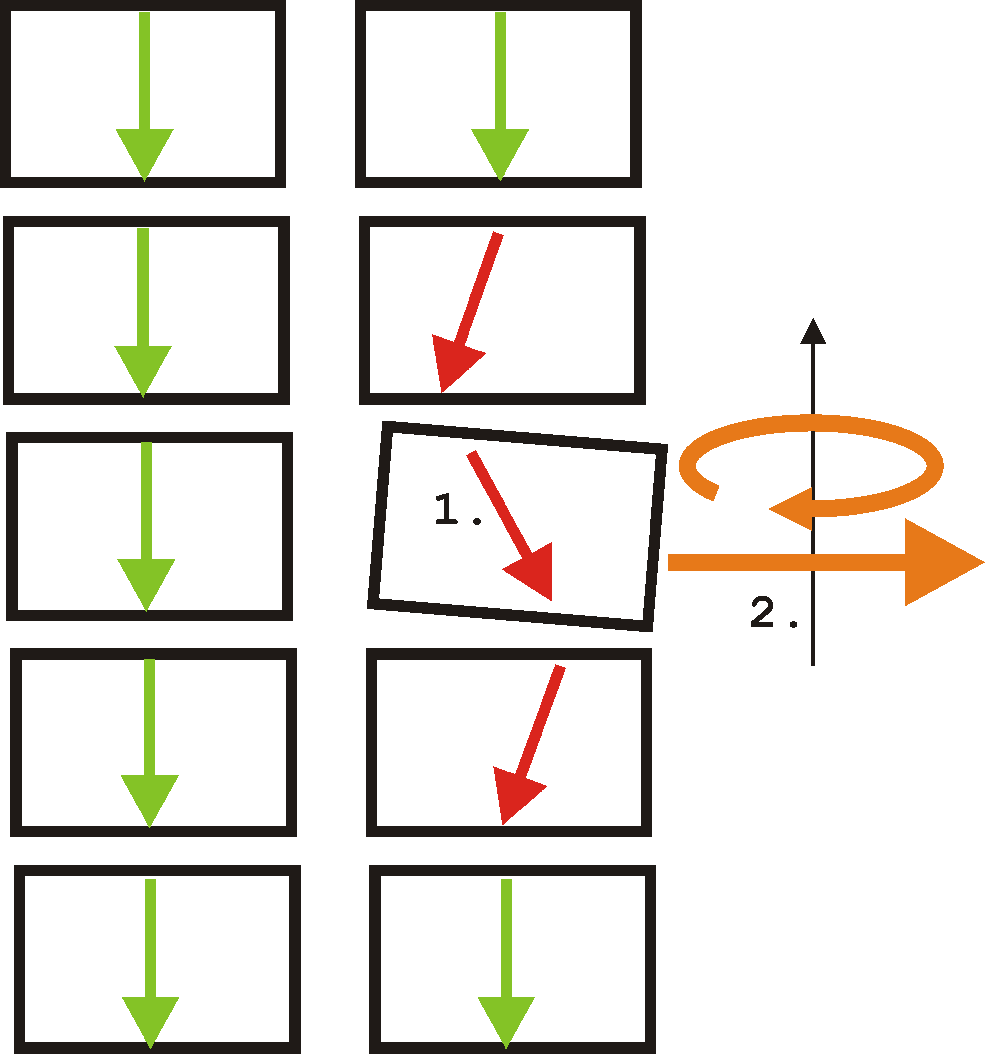 |
2. Das Wirbelsäulenblockierungsmuster bewirkt spezifische biokybernetische Änderungen der Stellmotoren (Muskeln) des Körpers, was zwangsläufig einen veränderten Tonus der Skelettmuskulatur in Bezug auf Haltung und Bewegung zur Folge hat.
Wie verhält es sich nun mit der Problematik von nicht ausgeglichener zu ausgeglichener Skoliose?
Wann kommt ein Skoliosierungsvorgang mit individuell ganz unterschiedlicher Ausprägung des Skoliosegrades (max. Winkel des Hauptskoliosebogens) zum Stillstand, wann beginnt er wieder von neuem, setzt sich fort, um endlich wieder zum Stillstand zu kommen?
Wie wir gesehen haben, besteht der Motor des Skoliosierungsvorganges in der Ausbildung eines Wirbelsäulenblockierungsmusters. Dabei entsteht eine auf jeden einzelnen Wirbel unterschiedlich skoliosierend wirkende Kraftresultante. Mit zunehmender Skolioseausbildung entsteht gleichzeitig aber auch ein biokybernetisch bedingtes Gegenpotential mit einer entgegengesetzten Kraft. Denn letztlich darf sich der initiale Skoliosierungsvorgang ja nicht verselbständigen und zur Dekompensation führen.
Ein solcher Fall wäre mit dem Leben unvereinbar und tritt deshalb unter normalen (funktionellen) Bedingungen ja auch nicht ein.
Solange also die skoliosierend wirkende Kraft größer ist als die biokybernetisch induzierte Gegenkraft, ist die Skoliose nicht ausgeglichen, und die Skoliosierung nimmt zu. In dem Moment aber, indem beide Kräfte gleich groß sind, hört dieser Vorgang auf. Damit geht die nicht ausgeglichene in eine ausgeglichene Skoliose über.
Nimmt jedoch auf Grund weiterer akuter wie chronischer Überlastung die funktionelle Dekompensation der Wirbelsäule weiter zu, so vergrößert sich auch die Skoliosierungskraft und das Gleichgewicht wird wieder in Richtung zunehmender Skoliosierung verschoben, solange, bis das System erneut ins Gleichgewicht übergeht.
Ein solcher Vorgang kann sich im Laufe des Lebens mehrmals wiederholen. Er kann aber auch nur einmalig auftreten, was glücklicherweise meist der Fall ist (leichte Skoliosierungen, die nahezu jeder hat).
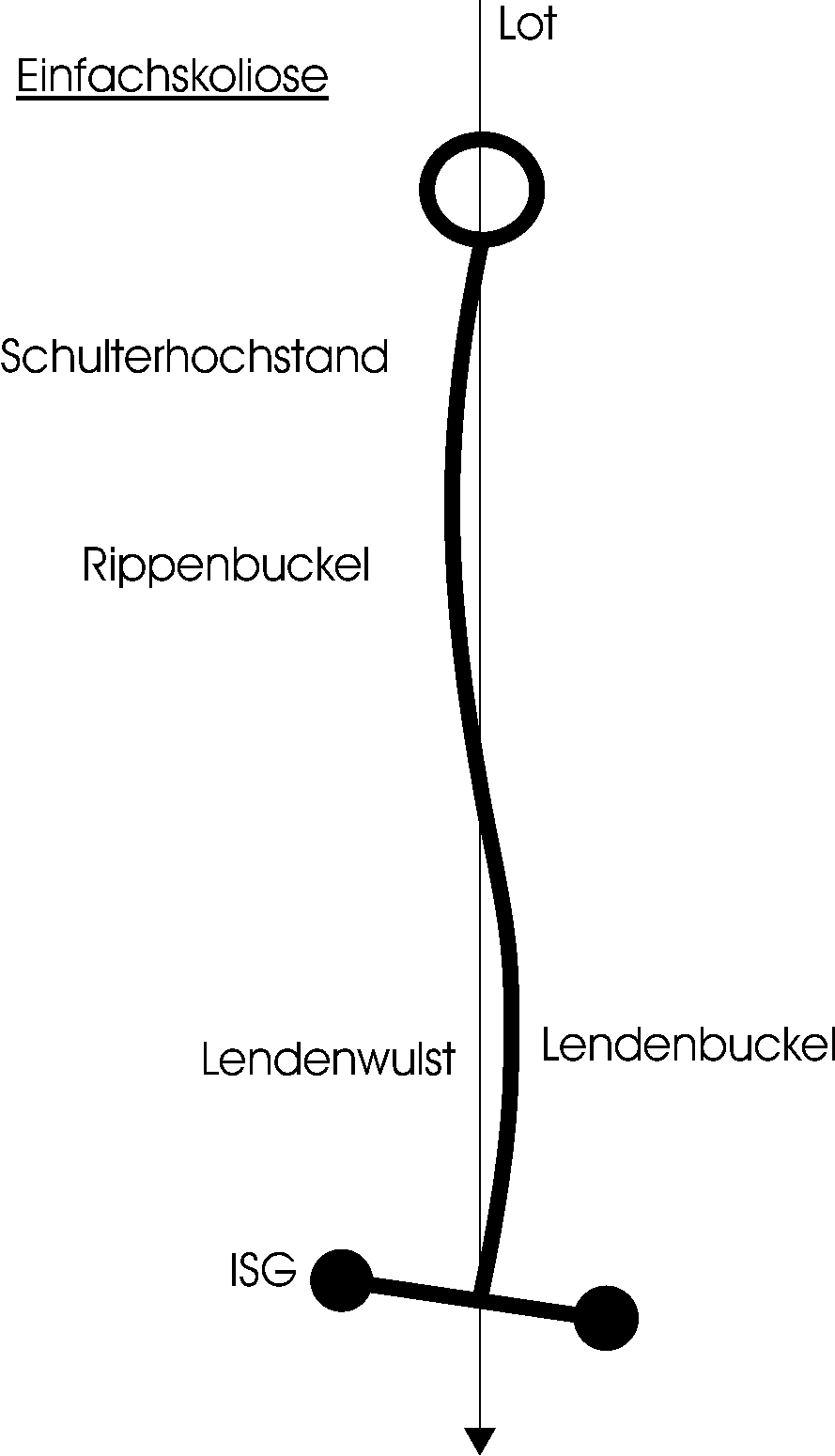 |
Sehr viel häufiger sind - nach dem Vorhergehenden gleichbedeutend mit den höheren Blockierungsmustern - Mehrfachskoliosen, die z. T. auf den ersten Blick gar nicht so einfach zu erkennen sind. Erst bei subtilerer Chirodiagnostik fallen auch Subskoliosen auf, deren Skoliosebogen nicht selten nur über 3 Wirbel geht.
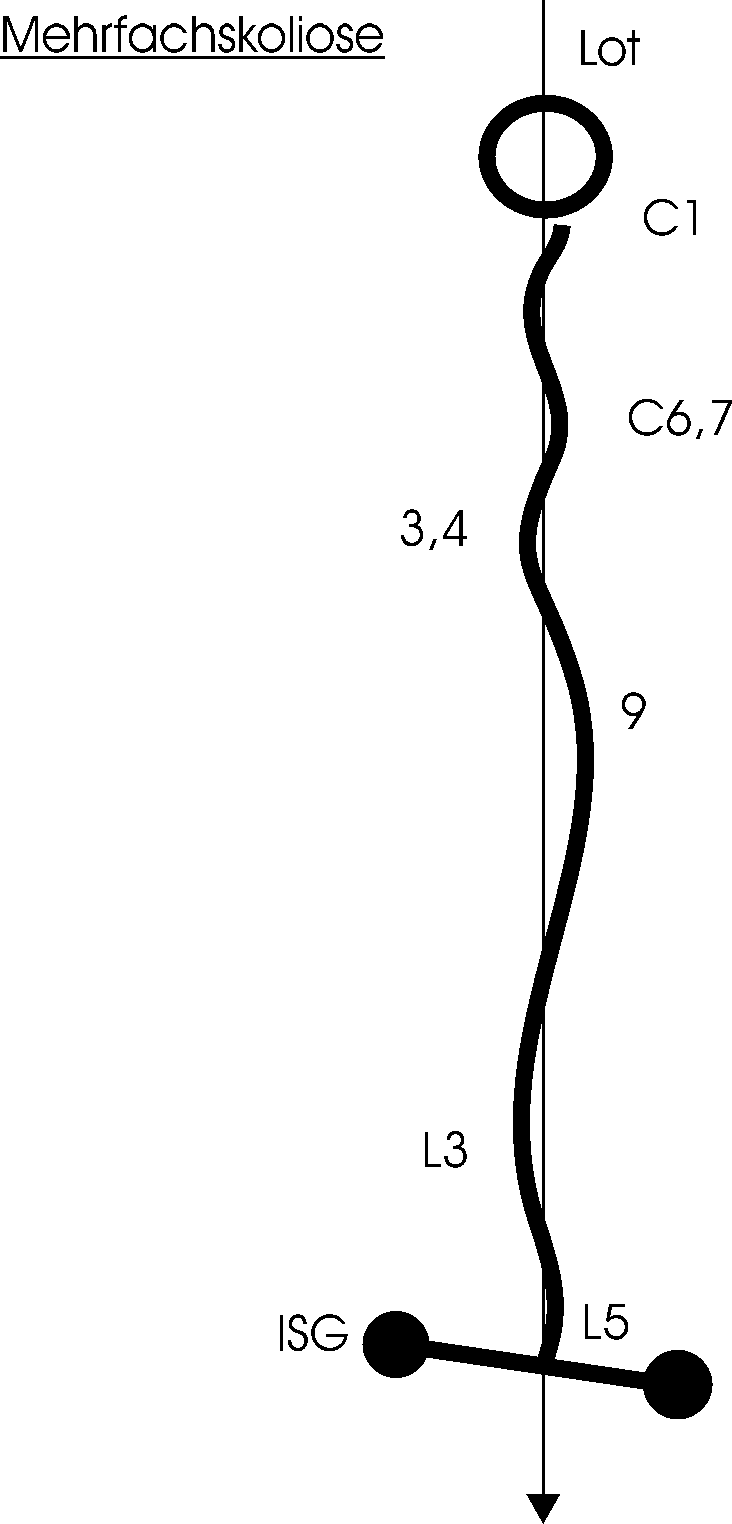 |
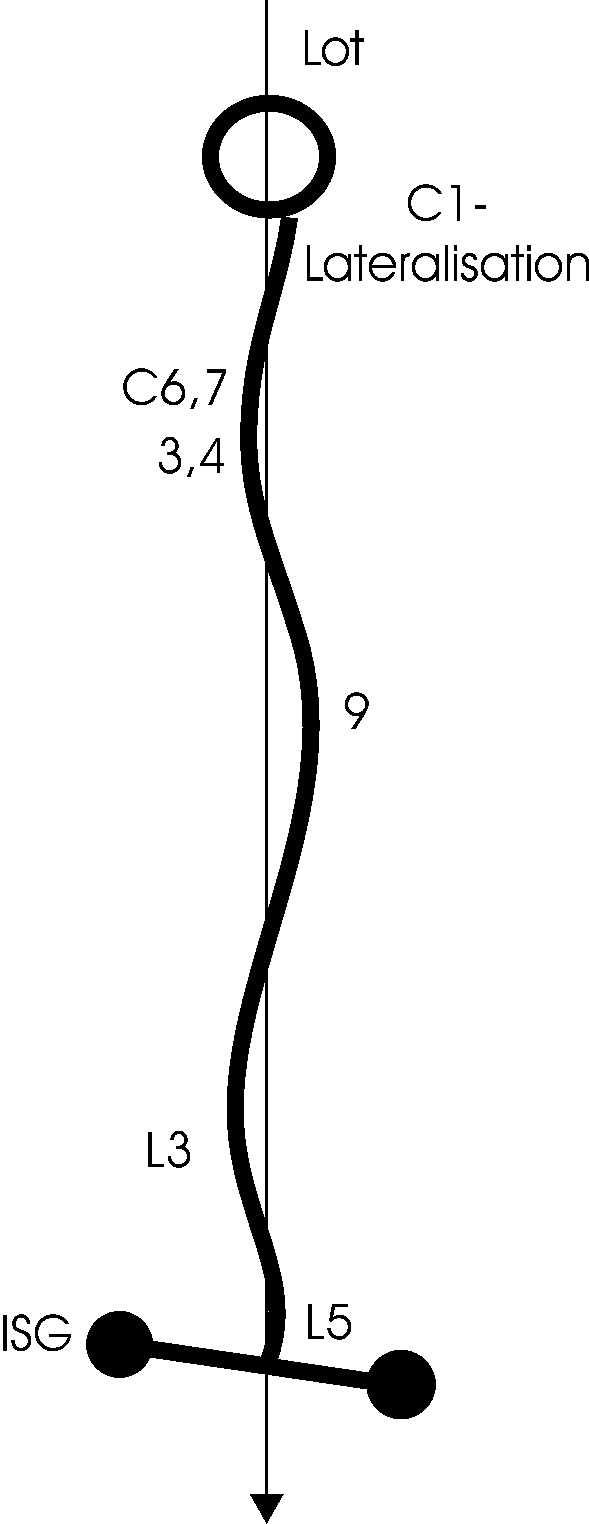 |
Der Grund hierfür besteht in dem für Knochen typischen Metabolismus, der vergleichsweise zu anderen Geweben sehr träge abläuft.
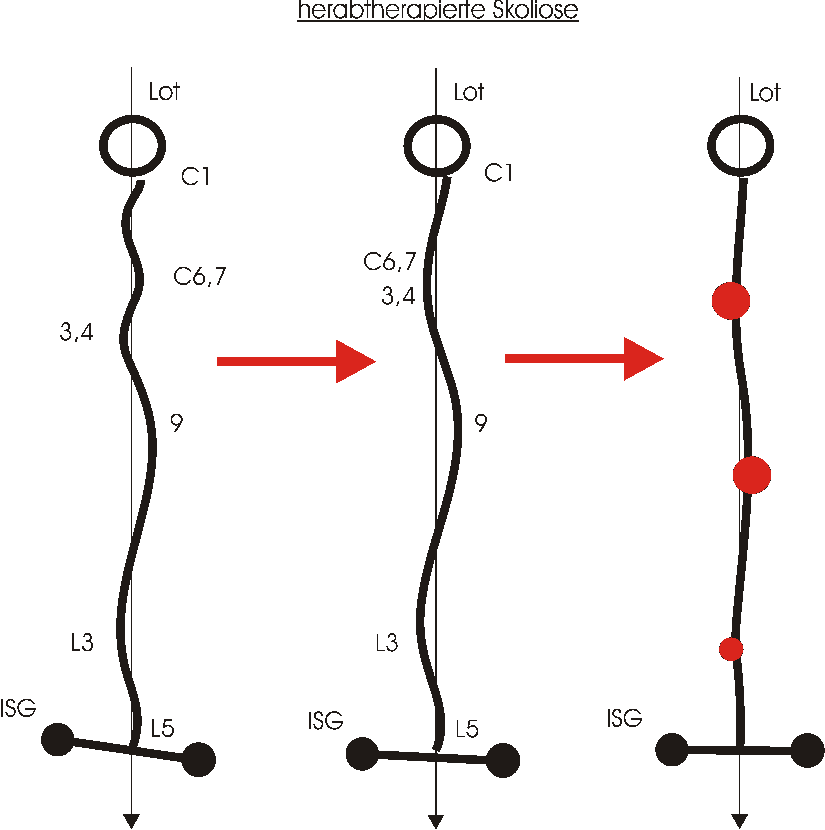 |
Ist es jedoch erst einmal (nach vielen Mühen) gelungen, annähernd bis zum Bild einer Einfachskoliose zu gelangen, beschränkt sich die weitere chirotherapeutische Mit- bzw. Nachbehandlung fast nur noch auf die Deblockierung der die Einfachskoliose aufrechterhaltenen Blockaden in den (beiden) Skoliosescheiteln.
Der weitere therapeutische Fortschritt bleibt nunmehr allein krankengymnastischer Fachbehandlung und nicht zuletzt - insbesondere was die Aufrechterhaltung und Langzeitkonstanz des erreichten Therapieergebnisses anbelangt - einer erhöhten Eigenverantwortung des Patienten bzgl. der (lebenslangen) Einhaltung geeigneter Therapieempfehlungen vorbehalten.
Fachspezifische Krankengymnastik und zunehmend auch Selbsttherapie durch den Patienten beginnen jedoch schon lange vorher, allerdings sinnvoller Weise immer auf der Basis eines maximal blockadefreien (deblockierten) Wirbelsäulenzustandes.
Jede(r) erfahrene Krankengymnast(in) weiß, daß physikalische Therapie auf eine "nicht funktionierende" Wirbelsäule angewandt, nicht selten zur Verschlimmerung der Symptomatik führt, so daß oftmals die Therapie abgebrochen wird (werden muß). Damit sind nicht nur finanzielle Ressourcen vergeudet, sondern auch das Gegenteil von dem erreicht, was ursprünglich beabsichtigt ist. Weitaus schlimmer ist jedoch, daß eine hocheffiziente Behandlungsmethode unberechtigter Weise in der "öffentlichen Meinung" in Mißkredit gerät, nur weil ärztliche Vorbehandlung versagt und zielgerichtete Therapieanweisungen fehlen.
Genau an dieser Stelle bewähren sich alternativmedizinische Fachkompetenz sowohl im heilpraktischen als auch im krankengymnastischen Bereich, so daß Patienten immer mehr gerade auch ihrem physiotherapeutischen Behandler ein erhöhtes Vertrauen entgegenbringen.
Wie könnte nun ein alternativ-krankengymnastisch-antiskoliotisches Behandlungskonzept aussehen?
Betrachten wir zunächst das z. Zt. am weitverbreitetsten und häufigsten angewendete Antiskoliosekonzept nach Schroth [4]. Dieses Konzept scheint aus der Sicht der hier vorgestellten chirotheoretischen Grundbetrachtungen mit 3 wesentlichen Nachteilen behaftet:
1. Die krankengymnastische Behandlung ist primärer Natur und erfolgt auf eine ansonsten unvorbehandelte Wirbelsäule hohen Skoliosepotentials.
Den obigen theoretischen Vorstellungen zufolge sollte jedoch sinnvollerweise jedwede krankengymnastische Behandlung funktioneller Wirbelsäulensyndrome, also insbesondere auch eine antiskoliotische Therapie immer bei einem Zustand maximaler Deblockierung, also, zum jeweiligen Behandlungszeitpunkt chirotherapeutisch optimal erreichbarer Funktionsintegrität der Wirbelsäule, erfolgen. Denn, allein durch die chirotherapeutisch bedingte Reduzierung des die Skoliose bedingenden Potentials verbessert sich das Ausmaß der Skoliose (Skoliosewinkel) wesentlich, so daß die nachfolgende krankengymnastische Therapie - wie oben ausgeführt - von erheblich höherer Effizienz und Akzeptanz ist. Insofern ist Krankengymnastik immer Nachfolgebehandlung, sofern sie nicht selbst chirotherapeutischen (Teil-)Behandlungscharakter annimmt, indem engagiertes KG-Personal - insbesondere bei weitgehend herabtherapierten Wirbelsäulensyndromen - im Rahmen ihrer Möglichkeiten chirotherapeutisches Wissen und Können erfolgreich anwendet.
2. Die Halswirbelsäule wird in das Schroth´schen Behandlungskonzept nur als zwangläufig dem Schultergürtel "funktionell zugehörige Verlängerung" ("Schulter-Hals-Keil"), nicht aber als autonom an der (Gesamt-)Skoliosierung beteiligtes Teilorgan einbezogen.
Wie wir aber gesehen haben, sind in der Nativentwicklung einer Skoliose immer alle Wirbel - also auch die Halswirbelsäule - involviert. Darüber hinaus unterliegen sogar der Becken- und der Schultergürtel mit ihren peripheren Anteilen, der Brustkorb und auch der Schädel - kurz das gesamte Skelett reaktiven Veränderungen mit individuell unterschiedlichen klinischen Auswirkungen. Wird also die Halswirbelsäule nicht mitbehandelt, so ist durchaus verständlich, daß es zur verstärkten Ausbildung von spezifischen Halswirbelsäulensyndromen aller Art bis zur Migräne kommen kann.
Genau das kann nicht Sinn einer funktionellen Therapie der Wirbelsäule sein.
3. Nach dem Schroth`schen Therapiekonzept werden Muskeln und Muskelgruppen aktiviert, die von Natur aus viel zu undifferenziert, da zu großflächig und mit viel zu wenig differentiell therapeutischen Ansatzstellen (Ansatzsehnen) versehen, sind.
Unter differentialtherapeutischen Gesichtspunkten gibt es nur ein Substrat, das in der Lage ist, eine differentielle, lokal exakt begrenzte und kraftmäßig gut abgestimmte antiskoliotisch wirkende Aktivität zu entfalten. Hierbei handelt es sich um den M. erector spinae mit seinen Teilmuskeln. Nur er liegt in unmittelbarer Nähe und angrenzend an die zu therapierenden Strukturen. Auf Grund seiner differenzierten Ansatzstruktur erreicht er jeden Wirbel einzeln und kann dementsprechend auch auf jeden Wirbel kraftmäßig unterschiedlich einwirken. Genau diese Eigenschaften sind es, die eine spezifische Antiskoliosetherapie ermöglichen.
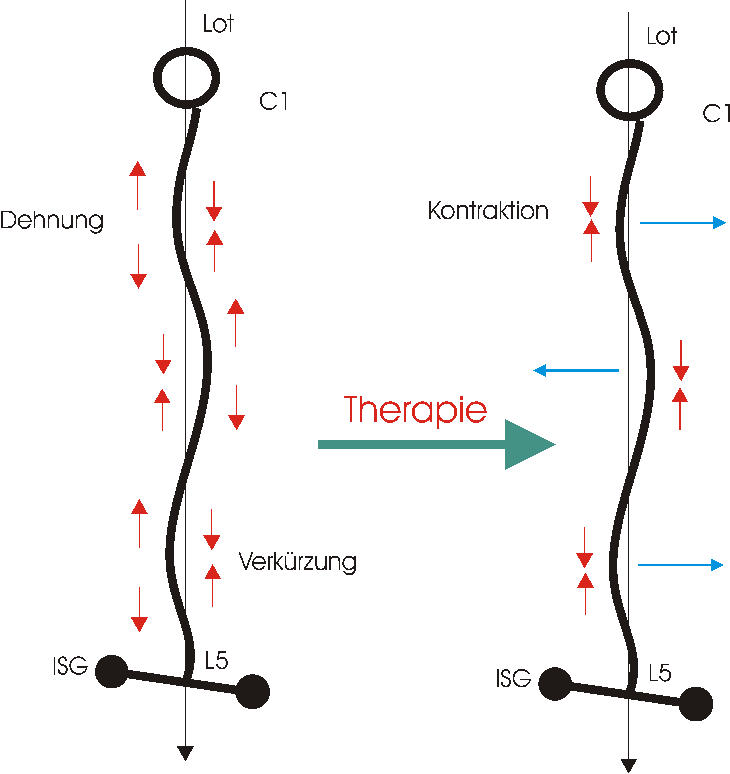 |
Die Umsetzung dieses Vorhabens zur Erreichung eines optimalen und langzeitstabilen Therapieergebnisses ist wesentlich an 3 Voraussetzungen geknüpft:
1. Fachkompetenz des KG-Therapeuten einschließlich ausreichender Kenntnisse der Chirodiagnostik,
2. den ausreichenden Willen des Patienten, seine Übungen zu jeder Zeit und passenden Gelegenheit auch außerhalb der KG-Praxis fortzuführen und
3. seine Fähigkeit, Empfehlungen zur Veränderung der Lebensführung mit dem Ziel eines schonenderen Umganges mit Wirbelsäule (Therapieempfehlungen) konsequent in die Praxis umzusetzen.
Ein wesentlicher Punkt dieser Therapieempfehlungen besteht darin, therapierte Skoliosebereiche in der Lumbalregion nicht mehr forciert dem Vorgang des Bückens auszusetzen, sondern zur Verminderung oder bestenfalls Vermeidung einer erhöhten Reblockierungs- und damit Reskoliosierungsgefahr nach Möglichkeit die Lendenwirbelsäule nur noch anzubücken. Der weitaus größere Teil des Bückvorganges sollte durch Hocken (Beugung in den Kniegelenken) - soweit möglich - ersetzt werden. Dies ist vor allem sinnvoll beim Heben größerer Lasten und ist im Zusammenhang mit Rehabilitationsmaßnahmen, aber auch zur Prophylaxe von Bandscheibenprozessen schon lange bekannter Bestandteil von Rückenschulen.
Wodurch wird diese erhöhte Reskoliosierungstendenz erklärbar?
Beim Bücken gerät der Skoliosebogen in doppelter Weise unter Spannung:
a) Er wird abgeflacht (Schober) und übt eine tangentiale Spannung auf die Bogenenden aus (drückt praktisch die Wirbelkörper in die Blockierungsstellung zurück).
b) Durch die Verbiegung in einer Ebene senkrecht zur Bogenebene entsteht eine doppelseitige Drillkraft (Verdrillung).
Diese beiden Kräfte sind es, die ihre schädliche Wirkung reskoliosierend entfalten und daher - soweit irgend möglich - minimiert werden müssen. (Zur prinzipiellen Überprüfung und Vergegenwärtigung dieses Sachverhaltes versuche man sich an einem Sportschützenbogen!)
In ähnlicher Weise laufen die Vorgänge an der Brustwirbelsäule ab. Allerdings ist hier die Abflachung geringer (Ott), wohingegen wiederum chronische Belastungsvorgänge über die Arme (Lenkrad, Computer u.a.) überwiegen können.
Zusammenfassend kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daß das Thema "Skoliose - Entstehung und Therapie" ein hochkomplexes Thema ist, dessen Weisheit letzter Schluß noch lange nicht gefunden ist. Erfreulich wäre jedoch, wenn der vorliegende Artikel Anlaß für weiteren Diskussionen ist, die dazu beitragen, den Erkenntnisstand zum Komplexthema Skoliose zu mehren und zum Vorteil betroffener Patienten noch besser praxisrelevant zu machen.
Literatur:
[1] Orthopädie · F.U. Niethard, J. Pfeil · Hippakrates Verlag Stuttgart 1989
[2] Roche Lexikon Medizin, 3.Auflage, Urban & Schwarzenberg 1993
[3] Syndrome der Wirbelsäule des Menschen · B. Gramlich · ML Verlagsgesellschaft MBH · Uelzen 2000
[4] Ch. Lehnert-Schroth · Dreidimensionale Skoliose-Behandlung · Urban & Fischer, München · Jena, 6., erweiterte Auflage 2000